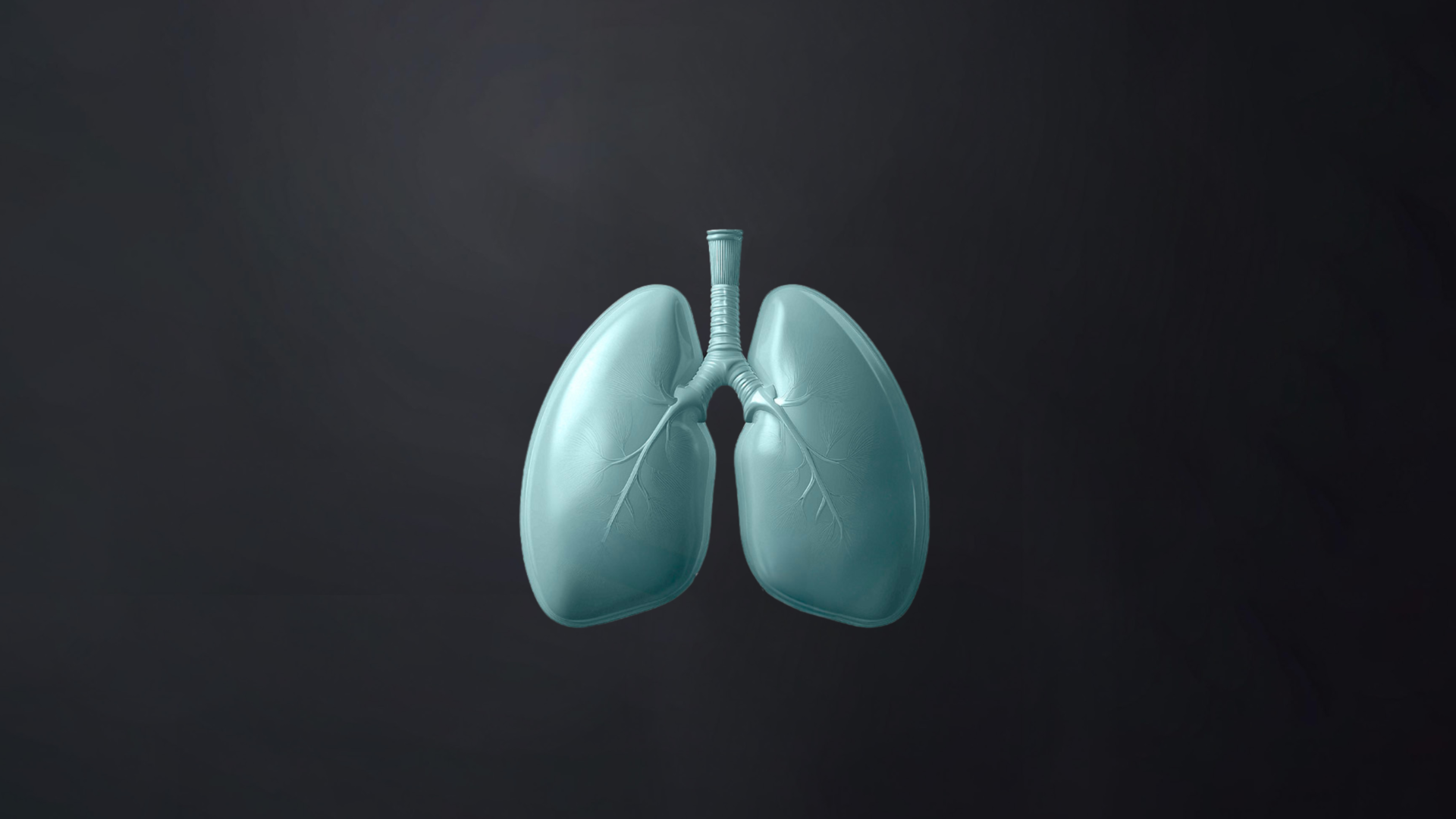
Ihre Lungengesundheit liegt uns am Herzen
Ohne Luft kein Leben: Mit jedem Atemzug wird unser Körper mit Sauerstoff versorgt. Atmen geschieht meist unbemerkt. Erst wenn unsere Lunge nicht mehr richtig funktioniert, spüren wir, wie wichtig sie für unsere Gesundheit ist.
Auf dieser Fokusseite erfahren Sie Wissenswertes über die Lunge. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Durchscrollen.
5 Fragen – 5 Antworten
Fünf Fachpersonen beantworten Fragen zu Themen rund um die Pneumologie und Thoraxchirurgie.
-
Ja, die gibt es. Asthma ist und bleibt eine Volkskrankheit: 8-9 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind betroffen. In unserer pneumologischen Spezialsprechstunde betreuen wir täglich Menschen mit Asthma.
Das Ziel der Asthmabehandlung ist heute, die Erkrankung vollständig unter Kontrolle zu bringen und keine Asthmaanfälle mehr zu bekommen – ganz ohne Kortisontabletten. Wenn dies erreicht wird, spricht man von einer «klinischen Remission» – einem Zustand, in dem Patientinnen und Patienten beschwerdefrei leben können.
Es gibt verschiedene Schweregrade von Asthma. Die Erkrankung wird auf einer Skala von 1 bis 5 eingestuft. Je höher der Schweregrad, desto schwieriger ist es, das Asthma unter Kontrolle zu bringen. Besonders für Patientinnen und Patienten mit schwerem Asthma (Stufe 5) haben sich in den letzten Jahren grosse Fortschritte ergeben: Neben Allgemeinmassnahmen und inhalativen Basismedikamenten («Asthmasprays») stehen eine Reihe moderner Antikörpertherapien zur Verfügung. Diese sind hoch wirksam und haben erfreulicherweise keine relevanten Nebenwirkungen.
Prof. Dr. med. Hans-Joachim Kabitz, Chefarzt Pneumologie und Schlafmedizin
-
Über 60 Prozent der Raucherinnen und Raucher wollen aufhören, aber die Erfolgsrate ohne Unterstützung liegt nur bei etwa 3 Prozent. Der schwierige Verzicht auf Zigaretten hat sowohl körperliche als auch psychologische und soziale Ursachen.
Nikotin wirkt direkt auf das Belohnungssystem im Gehirn und macht kurzfristig wacher und entspannter. Mit der Zeit entwickelt der Körper eine Toleranz, d. h. es werden grössere Mengen benötigt, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Entzugserscheinungen wie Reizbarkeit und starkes Verlangen erschweren das Aufhören. Hinzu kommt, dass Rauchen für manche eine Möglichkeit ist, um Stress abzubauen. Für viele ist es mit Gewohnheiten und Ritualen verbunden, etwa zusammen mit dem Kaffee am Morgen oder während der Pause bei der Arbeit. Auch Freunde oder Kolleginnen und Kollegen, die rauchen, erschweren den Rauchstopp.
Erfolgreich aufhören erfordert eine gute Vorbereitung, Unterstützung und Strategien zur Bewältigung von Entzugserscheinungen. Durch Nikotinberatung und individuelle Massnahmen lassen sich die Erfolgschancen deutlich verbessern.
-
Das übermässige Schwitzen an den Händen ohne körperliche Anstrengung wird als palmare Hyperhidrose bezeichnet. Dieses Krankheitsbild kann den Alltag erheblich beeinträchtigen – sei es bei der Arbeit, in sozialen Interaktionen oder bei einfachen Aufgaben wie dem Halten von Gegenständen.
Die Ursache ist nicht vollständig geklärt. Oft liegt eine Überaktivierung der Schweissdrüsen durch das autonome Nervensystem vor. Häufig sind mehrere Mitglieder einer Familie betroffen. Stress, Nervosität und bestimmte Lebensmittel können das Schwitzen verstärken.
Zunächst wird die palmare Hyperhidrose meist mit speziellen, so genannten Schweisshemmern behandelt, die direkt auf die Haut aufgetragen werden und die Schweissdrüsen blockieren. Führt dies nicht zur Linderung, kann eine Iontophorese-Therapie durchgeführt werden. Dabei werden die Hände regelmässig in Salzwasser getaucht, während ein schwacher elektrischer Strom das Schwitzen reduziert. Bleibt diese Therapie erfolglos, können die Nervenfasern, die für die Regulation der Schweissdrüsen an den Händen verantwortlich sind und im Brustkorb verlaufen, operativ durchtrennt werden. Der Vorteil dieser thoraxchirurgischen Methode ist, dass das Schwitzen damit vollständig aufhört.
-
Die nicht-operativen Behandlungsmöglichkeiten umfassen Physiotherapie zur Stärkung der Muskulatur, Dehnung des Brustkorbs sowie die Saugglockentherapie. Dabei wird das Brustbein durch Unterdruck angehoben. Diese Behandlung erfolgt täglich über mehrere Stunden und dauert mindestens ein Jahr.
Bei einer operativen Korrektur gibt es verschiedene Verfahren, die je nach Ausprägung der Trichterbrust angewendet werden. Beim Füllungsverfahren wird die Delle mit Silikonimplantaten oder eigenem Körperfett operativ ausgeglichen. Die Nuss-Methode ist die häufigste Operationstechnik: Hierbei wird ein Metallbügel minimal-invasiv eingeführt, um das Brustbein von innen anzuheben. Der Bügel wird nach 2 bis 3 Jahren wieder entfernt.
Bei stark ausgeprägten Deformitäten kann die sogenannte Ravitch-Operation erforderlich sein. Hier wird die Krümmung des Brustbeins korrigiert und der Rippenknorpel gekürzt. Bei diesem Verfahren werden zur Stabilisierung häufig Metallimplantate angewendet. Diese können nach 6 bis 12 Monaten wieder entfernt werden. Vor der Operation sind eine Magnetresonanztomographie oder Computertomographie des Brustkorbes sowie Herz- und Lungenuntersuchungen.
-
In der Schweiz gibt es noch kein flächendeckendes Früherkennungsprogramm. In anderen Ländern wie Polen oder Kroatien existieren diese bereits. Vor allem bei Risikogruppen hat sich die Durchführung einer niedrig dosierten Computertomographie der Lunge zur Früherkennung von Lungenkrebs in Studien als wirksam erwiesen.
Lungenkrebs zählt zu den häufigsten und tödlichsten Krebsarten – auch in der Schweiz. Je früher er erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Leider sind die Symptome oft sehr unspezifisch und werden erst bemerkt, wenn der Krebs schon weit fortgeschritten ist. Für eine Heilung kann es dann schon zu spät sein.
Zu den Risikogruppen zählen zum Beispiel starke Raucherinnen und Raucher ab 50 Jahren. Als starkes Rauchen gilt in der Regel ein Rauchkonsum von mindestens einer Schachtel Zigaretten pro Tag über 20 Jahre. Auch ehemalige Raucherinnen und Raucher gehören zur Risikogruppe.
Ein nationales Screening-Programm für die Schweiz wird diskutiert, aber noch sind die Rahmenbedingungen hierfür nicht geklärt. Die Rauchprävention bleibt eine der effektivsten Massnahmen, um das Risiko für Lungenkrebs zu senken.

Lungengesundheit und Schlaf im Fokus
Lungenkarzinom
Lungenkrebs ist die häufigste tödliche Krebserkrankung in der Schweiz. Der Pneumologe Thomas Ertl und der Thoraxchirurg Max Lacour erklären im Interview, warum die Früherkennung so schwierig ist und wie eine Lungenoperation abläuft.

Was tun, wenn man nicht mehr schlafen kann?
Schlafstörungen sind weit verbreitet und sollten ernst genommen werden. Ob Schlafmessung bequem von zu Hause aus oder eine Nacht im Schlaflabor: Erfahren Sie, wie Fachleute am KSA helfen, die Ursache von Schlafproblemen zu finden und gezielt zu behandeln.

Leben mit COPD
Urs Koch ist 62 Jahre alt und leidet an COPD, einer chronischen Lungenerkrankung. Schon kleine Anstrengungen im Alltag erschweren ihm das Atmen. Im persönlichen Interview spricht Urs Koch über seine Krankheit und seinen grössten Wunsch für die Zukunft.

Lungenfibrose
Die Ursachen der Lungenfibrose sind vielfältig, eine Heilung gibt es nicht. Welche Möglichkeiten es gibt, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen und die Lebensqualität zu erhalten, erfahren Sie in diesem Bericht.



